Ein Leitfaden für die Wohnungswirtschaft & Immobilienbesitzende
Der Aufbau von Ladeinfrastruktur bietet für Wohn-ungsunternehmen einerseits die Möglichkeiten ihre Immobilie zukunftsgerecht und modern aufzustellen; es bringt andererseits aber auch Herausforderungen bei Planung, Umsetzung und Betrieb mit sich.
Um die Einarbeitung in das Thema zu vereinfachen und um bei der Planung einer zukunftsfähigen Ladeinfrastruktur zu unterstützen, wurde ein Leitfaden entwickelt, der die konzeptionellen und technischen Rahmenbedingungen im Wohnungs-wesen in drei übersichtlichen Kapiteln abbildet.

⠀
Der Leitfaden "Aufbau von Ladeinfrastruktur – ein Leitfaden für die Wohnungswirtschaft und Immobilienbesitzende" unterstützt beim Aufbau von Ladeinfrastruktur. → zum Leitfaden
Kapitel 1: Konzeptionierung der Ladeinfrastruktur
In einem ersten Schritt sollte der aktuelle und zukünftige Ladeinfrastrukturbedarf ermittelt werden. Bei Neubauprojekten gelten dazu → rechtliche Vorgaben (GEIG), in Bestandsgebäuden kann der Bedarf zum Beispiel mithilfe einer Umfrage unter den Mieter:innen bestimmt werden.
Anschließend kann ein Ladekonzept festgelegt werden. Je nach Art der Zuordnung und der Anzahl der zu elektrifizierenden Stellplätze ergeben sich verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten für die Ladeinfrastruktur.
Rechtliche Vorgaben für Wohngebäude (GEIG)
Stellplätze im/ am Gebäude | Leitungs- infrastruktur ⁽²⁾ | Ladeinfra- struktur | |
|---|---|---|---|
Errichtung / Neubau | mehr als 5 | jeder Stellplatz | ----------- |
Größere Renovierung ⁽¹⁾ | mehr als 10 | jeder Stellplatz | ----------- |
⁽¹⁾ "Renovierung eines Gebäudes, bei der mehr als 25 Prozent der Oberfläche
der Gebäudehülle einer Renovierung unterzogen werden" (§ 2 Nr. 5 GEIG)
⁽²⁾ "Gesamtheit aller Leitungsführungen zur Aufnahme von elektro- und
datentechnischen Leitungen [...]" (§ 2 Nr. 5 GEIG)
⠀
Ladekonzepte
⠀
Kosteneffizienter Aufbau von Ladeinfrastruktur
Die Errichtung von Ladeinfrastruktur muss gerade zu Beginn möglichst kosteneffizient erfolgen, da die Kosten anfangs nur auf wenige Nutzer:innen aufgeteilt werden können. Zusammen mit der Nutzung von → Förderprogrammen sollte daher im ersten Ausbauschritt der aktuelle Ladebedarf mit geteilten Ladestationen (Sharing-Ladekonzept) abgedeckt werden. Gleichzeitig sollte eine flächendeckende Grundinstallation aufgebaut werden, um eine skalierbare und damit zukunftssichere Ladeinfrastruktur zu schaffen.
Kapitel 2: Betriebsmodelle
Zusammenspiel der verschiedenen Akteur:innen
Wohnungsunternehmen besitzen die Stellplätze und beauftragen bzw. gestatten die Errichtung der Ladeinfrastruktur. Dazu sind Absprachen mit den Verteilnetzbetreibenden notwendig, die für alle Netzanschluss-Veränderungen zuständig sind.
Im Zentrum der Ladeinfrastruktur stehen die Ladepunkt-Betreibenden, die – vom Wohnungsunternehmen beauftragt – den Strom-vertrag mit dem Energieversorgungsunternehmen abschließen, Ladekarten an die Nutzer:innen ausgeben und den Strom sowie die Nutzung der Infrastruktur abrechnen.
⠀
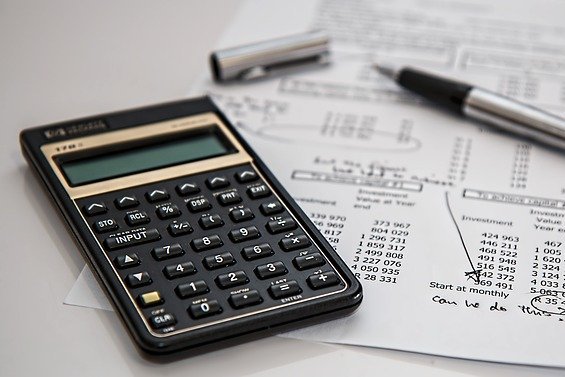
⠀
Betrieb der Ladeinfrastruktur auslagern
Der Betrieb einer Ladeinfrastruktur ist nicht zwangs-läufig mit mehr personellem Aufwand verbunden. Insbesondere die operativen Aufgaben werden in der Regel an externe Dienstleistungsunternehmen delegiert. Diese treten gegenüber den Nutzer:innen als Vertragspartei auf und stellen den reibungslosen Betrieb der Ladeinfrastruktur sicher.
Kapitel 3: Elektroinstallation und Netzanschluss
Der Netzanschluss von Wohngebäuden wird nach der DIN 18015-1 ausgelegt. Obwohl in dieser Norm der Leistungsbedarf von Ladestationen bisher nicht berücksichtigt wird, hat dennoch jeder Netz-anschluss eine gewissen Leistungsreserve, die für eine Ladeinfrastruktur genutzt werden kann.
Mithilfe eines übergeordneten → Lastmanagementsystems können so auch mehrere Fahrzeuge gleichzeitig laden, ohne den Netzanschluss mit baulichen Maßnahmen verstärken zu müssen.

Downloads
Der Leitfaden "Aufbau von Ladeinfrastruktur – ein Leitfaden für die Wohnungswirtschaft und Immobilienbesitzende" unterstützt beim Aufbau von Ladeinfrastruktur. → zum Leitfaden
⠀
Die Publikation des GDV enthält Hinweise für die Planung, Installation und den sicheren Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge in geschlossenen Garagen. → zur Publikation [extern]
Sharing: Teilen ist das neue Besitzen
CarSharing ist der günstige und umweltschonendste Möglichkeit individueller Mobilität. Das Prinzip ist, dass sich mehrere Nutzende ein Fahrzeug teilen. Die Vorteile sind vielfältig: Es muss kein eigenes Fahrzeug gekauft und unterhalten werden, das dann 23 Stunden pro Tag herumsteht. Anschaffungs- und Betriebskosten entfallen - es werden nur die Kilometer gezahlt, wenn das Fahrzeug genutzt wird. Ein weiterer Vorteil ist die Einsparung von Parkraum, wenn ein Car-Sharing-Fahrzeug mehrere andere Fahrzeuge ersetzt.

⠀

Mobilitätsunternehmen (Auswahl)
Anbieter | Firmensitz |
|---|---|
Aachen | |
Dortmund | |
Aachen | |
Aachen | |
Essen |











